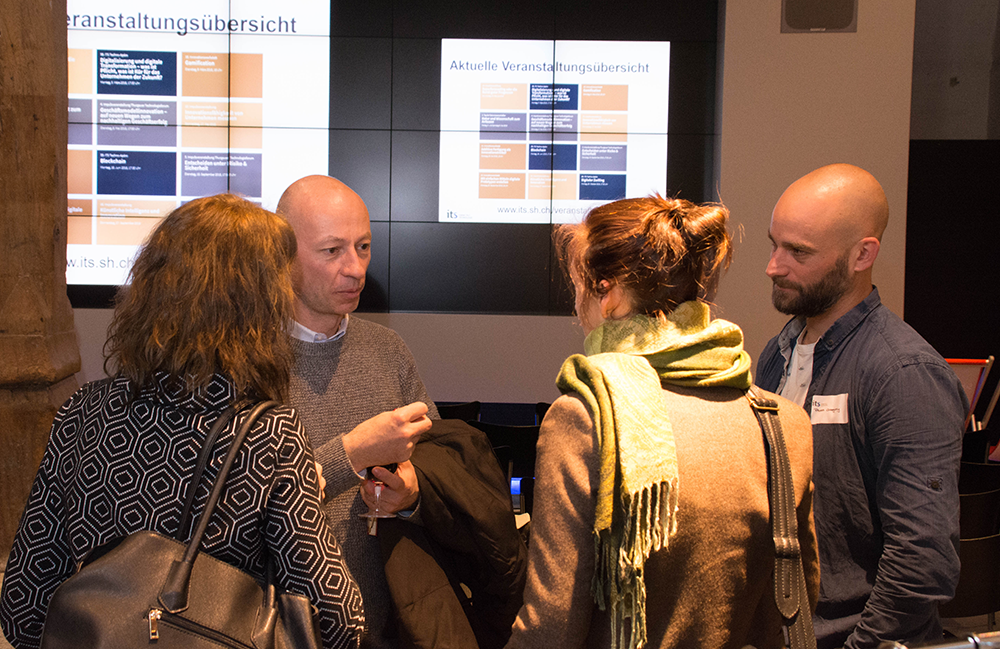14. Impulsveranstaltung
Superforecasting oder die Kunst guter Prognosen
Donnerstag, 15. Februar 2018
SHtotal, Parterre, Herrenacker 15, Schaffhausen (Lageplan)
Am Donnerstag, 15. Februar 2018, hat im Haus der Wirtschaft in Schaffhausen die 14. Impulsveranstaltung des ITS Industrie- und Technozentrum Schaffhausen und der Fachhochschule St. Gallen stattgefunden. In einem rund 60-minütigen Referat erläuterte Prof. Dr. Lukas Schmid vom Institut für Innovation, Design und Engineering der FH St. Gallen, die Wichtigkeit von Prognosen für Unternehmen – und wie diese verbessert werden können. Der Veranstaltung wohnten über 50 interessierte Firmenvertreter bei.
Impressionen:
Thema:
Bessere Prognosen dank Superforecasting
Wird der FC Schaffhausen noch in die Super League aufsteigen? Wie viele Medaillen gewinnen die Schweizer Olympioniken diesen Winter? Wird die No-Billag-Initiative angenommen oder abgelehnt? Wie wir solche Fragen beantworten, hängt oft von rationalen Überlegungen oder nicht selten auch unseren Bauchentscheiden ab. Tagein, tagaus werden Prognosen gemacht – sei es bei Wetten, Wettervorhersagen oder Kursentwicklungen von Aktien. «Häufig wurde etwa der Weltuntergang prognostiziert», leitete Prof. Dr. Lukas Schmid vom Institut für Innovation, Design und Engineering der FH St. Gallen sein Referat an der 14. Impulsveranstaltung im Haus der Wirtschaft auf dem Herrenacker ein. Bereits mehrere Hundert Jahre vor Christus wurde im antiken Griechenland das Ende der Zeit für das Jahr 500 n. Chr. Vorausgesagt – und seither unzählige Male erfolglos wiederholt. Ist es daher weise, sich erst nach einem Ereignis auf dessen Ausgang festzulegen? «Beim Weltuntergang schon, im unternehmerischen Umfeld hingegen nicht», so Schmid. Denn Abwarten sei keine Option wenn es etwa um Innovationsentscheide gehe. Und gerade bei unternehmerischen Entscheiden sei eine gute Prognose von hoher Bedeutung. «Nur wenige Personen sehen sich als fähig an, gute Prognosen auszustellen», sagte Schmid. Und doch würden Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft täglich Prognosen ausstellen und auf diesen basierend Entscheide fällen. «Doch oft wird die Voraussage nicht reflektiert und Entscheidungsträger sind sich deshalb ihrer Prognose(un-)fähigkeit nicht bewusst», betonte Schmid.
Prognosequalität ist messbar
Schmid verglich die heutigen Prognosen von zahlreichen Experten und Entscheidungsträgern mit der Medizin vor mehreren hundert Jahren. «Damals ging man bei Behandlungen oft nach dem Trial-and-Error-Prinzip vor und versuchte einfach möglichst viel aus, bis eine Behandlung endlich anschlug», so der Referent. Heute überprüfe man die Wirksamkeit eines Medikamentes hingegen durch Forschung mit Kontrollgruppen, um diese zu be- oder widerlegen. «Bei Prognosen machen wir das hingegen nicht», so Schmid. Deshalb sei oft unklar, ob jemand in der Regel treffsichere oder unpräzise Vorhersagen machen würde. Erst wenn man die Güte einer Prognose messe, gemacht wird dies mit dem sogenannten Brier-Score, kann man sich ein Bild machen, wie verlässlich eine Person oder ein Algorithmus Vorhersagen macht.
Superprognostiker gesucht
Einer, der sich vertieft mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, ist der Psychologe Philip Tetlock. Zwischen 2011 und 2015 befasste er sich mit dem noch jungen Forschungsfeld der Prognosen und liess über 2000 willkürlich ausgewählte Personen Prognosen zu aktuellen Fragen des Weltgeschehens aufstellen, um so mithilfe der Schwarmintelligenz bessere Voraussagen machen zu können. Dabei entdeckte er bald, dass einige Personen treffsicher waren, was ihre Prognosen anbelangte. Dies hing jedoch nicht von deren Intelligenz ab. Solche Superprognostiker zeichneten sich durch ihre Arbeits- und Denkweise aus, so Schmid. «Sie brechen ihre Ausgangsfrage auf Teilfragen herunter, ziehen verschiedene Informationsquellen mit ein und sind bereit, ihre eigenen Ansichten zu hinterfragen und anhand neuer Erkenntnisse zu aktualisieren», fasste Schmid zusammen. Und diese Denkweise lasse sich antrainieren. Deshalb gab er zum Schluss der Veranstaltung den Besuchern zehn Regeln mit, wie man bessere Prognosen machen könne – um in Zukunft bessere Vorhersagen im unternehmerischen Umfeld zu machen.
Programm:
Begrüssung durch Roger Roth
Referat durch Prof. Dr. Lukas Schmid, Institut für Innovation, Design und Engineering, FH St. Gallen
Diskussionsrunde
Kleiner Apéro und Networking